August 2025
JETZT ONLINE auf unserem YouTube Kanal

Der Main-Donau-Kanal ist unbestritten eine der großen Ingenieursleistungen des 20. Jahrhunderts. Eine Wasserstraße, die den Main mit der Donau und damit auch die Nordsee mit dem Schwarzen Meer verbindet. Doch dreißig Jahre nach seiner Fertigstellung fällt die Bilanz ernüchternd aus.

Am Hafen Nürnberg, einem der größten Güterverkehrszentren Süddeutschlands, zeigt sich, wie tief die Binnenschifffahrt in der Krise steckt. Wo einst Millionen Tonnen an Kohle, Erz oder Dünger umgeschlagen wurden, liegen die Kais heute oft leer. 2023 waren es noch rund 2,5 Millionen Tonnen, im Vergleich zur Schiene ein Bruchteil. Während LKW und Bahn immer schneller und flexibler geworden sind, kämpft das Binnenschiff mit langen Transportzeiten, Wartephasen an den Schleusen und sinkender Nachfrage.

Gleichzeitig verschlingt der Erhalt der Wasserstraße enorme Summen. Brücken müssen abgerissen und neu gebaut werden, Schleusen werden für hunderte Millionen saniert. Kritiker wie der BUND Naturschutz sprechen von einem ökologisch wie ökonomisch gescheiterten Projekt, einem »Millionengrab« mitten in Bayern. Sie verweisen auf die massiven Eingriffe in Natur und Landschaft, auf entwässerte Feuchtgebiete und verlorene Artenvielfalt.

Und doch: Der Main-Donau-Kanal bleibt Teil der europäischen Infrastruktur – und er erlebt einen Wandel. Die Containerisierung hat neue Formen der Logistik hervorgebracht, und im Flusstourismus zeigt sich eine Entwicklung, die niemand übersehen kann. 2024 legten in Nürnberg 750 Kreuzfahrtschiffe mit rund 100.000 Passagieren an. Für die Stadt ein wachsender Wirtschaftsfaktor, für die Gäste aus aller Welt ein erster Eindruck von Nürnbergs Geschichte und Kultur.

Die Reportage wirft einen Blick auf ein Bauwerk voller Widersprüche: zwischen sinkendem Frachtverkehr und boomender Kreuzschifffahrt, zwischen hohen Investitionen und einer unsicheren Zukunft.

Eine filmische Bestandsaufnahme über die Bedeutung des Main-Donau-Kanals heute und die Frage, welche Rolle er morgen noch spielen kann.
Juli 2025
JETZT ONLINE auf unserem YouTube Kanal

Am Ende des Zweiten Weltkriegs kamen die Amerikaner als Besatzer nach Bayern. Es war der Beginn einer spannungsreichen Wechselbeziehung, bei der sich das Kräftegewicht immer wieder verschob. In diesem Film begeben wir uns auf die Spurensuche zu 80 Jahren Deutsch-Amerikanischer Vergangenheit – an der Schwelle zu einer noch ungewissen Zukunft.

Der Start der Beziehung war durchaus schwierig: In Fürth fielen die Besatzer vor allem als trink- und rauffreudige Unruhestifter auf – denen schließlich sogar der Zugang zur Altstadt untersagt werden musste.

Heute ist das Verhältnis entspannter. Im Stützpunkt Hohenfels feiern Deutsche und Amerikaner jedes Jahr ein gemeinsames Volksfest und schauen sich gegenseitig Traditionen ab.
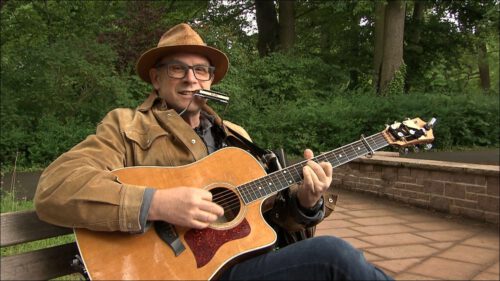
Doch seit der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump wird das Verhältnis wieder angespannter. Manche Amerikaner, wie George Kobrick, fühlen sich deshalb inzwischen in Deutschland mehr zu Hause als in Amerika.

Auch das Deutsch-Amerikanische Institut im Amerikahaus Nürnberg spürt den Kulturwandel: Beschäftigung mit Diversität oder Minderheiten ist nicht mehr offiziell erwünscht – findet aber trotzdem noch statt.
Juni 2025
JETZT ONLINE auf unserem YouTube Kanal

Er stammt aus einer Familie mit sieben Generationen Binnenschifffahrt, hat Logistik studiert, ist frischgebackener Vater – und lebt für seinen Job, der gleichzeitig Berufung ist:

Tobias Zöller ist Kapitän auf dem Schubverband Johannes von Nepomuk, der Tausende Tonnen Rapsschrot, Sojabohnen oder Eisenerz zwischen Rotterdam, Bamberg und Osijek in Kroatien bewegt.

Doch sein Beruf ist mehr als ein Transportunternehmen: Es ist eine Lebensart zwischen Technik, Natur und familiärer Verantwortung. Die Reportage begleitet Tobias durch Schleusen, Werftaufenthalte und lange Fahrtage auf dem Main-Donau-Kanal.

Sie zeigt, wie aus einem traditionellen Handwerk ein hochkomplexer Beruf geworden ist, der mit Fachkräftemangel, bürokratischen Hürden und Investitionsdruck für grüne Antriebe kämpft. Aber auch, wie entschleunigter Transport auf dem Wasser eine nachhaltige Antwort auf verstopfte Straßen sein kann.

Der Binnenschiffer Tobias Zöller berichtet vom Alltag an Bord, von Leichtmatrosen aus der Ukraine, von Rehen, die durchs Wasser schwimmen – und von Kindheitserinnerungen auf dem Schiff, das früher für ihn auch Abenteuerspielplatz war. Er kennt die technischen Feinheiten seines Motors ebenso wie die Herausforderungen einer familiären Work-Life-Balance auf dem Wasser.

Ein eindrückliches Porträt eines Mannes zwischen Vergangenheit und Zukunft. Es zeigt, wie moderne Binnenschifffahrt funktioniert – und warum das ruhige Fahrwasser zwischen hektischen Straßen und oft maroden Gleisen noch eine Zukunft haben kann.

Hier könnt Ihr die Reportage anschauen!
März 2025
JETZT ONLINE auf unserem YouTube Kanal

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in unseren Alltag – ob beim Schreiben, Recherchieren, Übersetzen oder Musikmachen. Doch was bedeutet dieser technologische Wandel für die Kunst? Wir haben uns an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg umgehört.

Constant Dullaart ist seit 2022 Professor an der AdBK. In seiner Klasse für Vernetzte Materialität geht es dem Konzeptkünstler, der schon lange mit und über KI arbeitet, darum, seinen Studierenden mitzugeben, wie Kunst im digitalen Raum entsteht, verteilt und wahrgenommen wird – zwischen Bildschirmen, Codes, Apps und klassischen Formaten. Für ihn leben wir »in einer ikonoklastischen Zeit, in der sich alles ändert.«

Wir haben Daniel Wessolek, den Leiter des Media Lab der AdBK besucht. Hier können Studierende mit analogen und digitalen Technologien experimentieren. Der Fokus liegt auf technischem Grundlagenwissen, eigenem Programmieren und auf der Frage, wie man als Künstler*in digitale Technologien aktiv mitgestalten kann. Der KI steht er ambivalent gegenüber. »Bisher haben mich die Ergebnisse nicht überzeugt.«

Wir haben den Studenten Robin kennen gelernt, der mit Hilfe von KI ein Musikvideo generiert hat, mit Paul gesprochen, der KI für Experimente mit Klang und Musik nutzt und den frisch gebackenen Absolventen Simon Schalle getroffen, der in seiner Abschlussarbeit den Zusammenhang zwischen KI, Raumfahrt und Ressourcenpolitik thematisiert.

Hier könnt Ihr die Reportage anschauen!
In den Sozialen Medien haben wir uns mit weiteren Aspekten des Themas Kunst und Künstliche Intelligenz beschäftigt:
- Playlist »Kann KI Kunst?« auf unserem YouTube Kanal
– Medien PRAXIS auf Instagram
– Medien PRAXIS auf Facebook
– Medien PRAXIS auf TikTok
Januar 2025
JETZT ONLINE auf unserem YouTube Kanal

Im Januar starten die Umbaumaßnahmen in der Breiten Gasse Nürnbergs. Ein Neustart soll gemacht werden. Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt hat in den letzten Jahren schwer gelitten. Nürnberg ist da nicht alleine. Der Einzelhandel steckt seit längerem in der Krise. Auch andere Städte haben damit zu kämpfen.

Nur, was nützen neue Bänke, mehr Grün und schönere Böden, wenn der Leerstand trotzdem da ist? In der Breiten Gasse ist die Situation besonders schlimm. Nur ganz wenige inhabergeführte Geschäfte sind hier noch übrig. Viel Ramsch und Fastfood macht sich breit.

Zu allem Überfluss stehen auch die großen Areale Kaufhof und CityPoint seit Jahren leer. Den Kaufhof hat nun die Stadt Nürnberg selbst erworben. Der CityPoint hat einen anderen potenten Käufer gefunden.

Nürnberg ist bemüht, den Gebäuden wieder Leben einzuhauchen. Sind solche Konsumtempel doch Anziehungspunkt und Frequenzbringer, die vom Einzelhandel gefordert werden. Aktuell wird das Kaufhof-Areal mit Kunst und Kultur bespielt. Ist das ein Konzept auch für andere Nutzungen?

Innenstädte wie Nürnberg oder Fürth suchen jedenfalls nach neuen Ideen zur Belebung ihrer Cities und Steigerung der Aufenthaltsqualität. Denn das Konsumverhalten hat sich in den letzten Jahren geändert. Onlinehandel und die wirtschaftlich schwierige Lage lässt Konsumenten ausbleiben. Was können Städte also noch dagegen tun?

Hier könnt Ihr die Reportage anschauen!
März 2023
Der Weinberg von Patrik Fritz unterhalb der Nürnberger Burg, am Ölberg, ist ein agrikultureller Ort. Hier wachsen nicht nur Rebstöcke, hier wächst im besten Fall auch immer Kunst und Kultur.

Begegnungen sind für den einzigen Winzer innerhalb der Stadtmauern wichtig. Er selbst ist stark an Künsten interessiert. Und so finden sich übers Jahr verteilt immer wieder Maler, Literaten und Musiker am Weinberg ein. Gemeinsam und oft mit Gästen oder Publikum wird der Weinberg so zum kreativen Ort.

Matthias Egersdörfer schreibt in seiner CURT-Kolumne über den Weinbau unter der Burg, der Zeichner Michael Jordan fertigt dazu die Illustrationen an. Die Künstlerin Lisa Wölfel portraitiert Menschen, die mit Fritz und seinem Wein in vielfältiger Weise in Verbindung stehen. Daraus entstehen dann die Etiketten für den Hauswein. Am Bardentreffen wird der Balkon von Patrik Fritz zur Bühne. Renommierte Bands sorgen für viel Betrieb am zwischen den Weinstöcken.

Wein wurde schon vor 500 Jahren unter der Burg gepflanzt. Der 30-jährige Krieg und eine kleine Eiszeit haben den Anbau ausgebremst. Nur ändert sich das Klima wieder. Der Wein profitiert davon. Auch der Nürnberger Peter Schmidt ist Weinbauer. Im Knoblauchsland will er sein Glück mit dem Weinanbau versuchen. Aber auch seine alten Lagen in Mainfranken müssen sich auf den Klimawandel einstellen.

Die Lese im Weinberg von Patrik Fritz bildet dann jedes Jahr den Höhepunkt des Jahres. Gemeinsam mit Freunden wird der Hauswein Clos Noris dann eingebracht.

Der Weinbau erlebt in Nürnberg also wieder eine Renaissance und könnte in Zukunft neben Bratwurst und Lebkuchen zum Exportschlager werden.

Februar 2023
Unterhalb der Nürnberger Burg, am Ölberg, wachsen seit ein paar Jahren auf einer Fläche von ca. 30 Quadratmetern sechs verschiedene Weinsorten. Für die Touristen, die vom Tiergärtner Tor hinauf zur Kaiserburg spazierten, ist das eine kleine Attraktion. Bringt man Nürnberg doch eher mit Bier als mit Wein in Verbindung.

Was die wenigsten wissen: Der Stadtwinzer Patrik Fritz produziert aus seinen 40 Rebstöcken einen alten Fränkischen Satz und lässt damit eine alte Tradition wieder aufleben. Denn vor rund 500 Jahren gab es schon einmal Weingärten in Nürnberg. Holzstiche und historische Chroniken aus der Zeit sind im Stadtarchiv noch vorhanden und zeigen, dass der Wein in Nürnberg einmal durchaus Konjunktur hatte.

Durch die veränderten klimatischen Verhältnisse ist es nun wieder zunehmend möglich, Wein im Stadtgebiet anzubauen. Nürnberg wird sich in Zukunft auf mehr Hitzetage einstellen müssen. Dementsprechend wird auch der Anbau von einst exotischen Pflanzen möglich werden.

Aus den Trauben von Patrik Fritz’ Reben entsteht Naturwein. Sein Weinberg ist ein natürliches Ökosystem. Diese Herangehensweise an den Weinanbau versucht er auch Interessierten bei den »Stadt(ver)»führungen näherzubringen.

Fritz ist zwar der einzige Nürnberger Winzer innerhalb der Stadtmauern, im Knoblauchsland entstand jedoch im Frühjahr 2022 ebenfalls ein Weinberg. Der Weinbauer Peter Schmidt aus Buch versucht sich im Norden Nürnbergs mit Weißem Burgunder und Sauvignon Blanc.

Der Weinbau erlebt in Nürnberg also wieder eine Renaissance und könnte in Zukunft neben Bratwurst und Lebkuchen zum Exportschlager werden. Der Klimawandel macht es möglich...
Juni 2021

2019 lag der Umsatz von biologischen Lebensmitteln in Deutschland bei 12 Milliarden Euro – das ist eine Steigerung um knapp 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dennoch machen Bio-Produkte lediglich 6 Prozent des gesamten Lebensmittelumsatzes in Deutschland aus. Nur 12 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe haben bisher auf Bio umgestellt.

Diese Zahl lässt sich auch auf das Knoblauchsland im Nürnberger Norden übertragen. Von den rund 130 Vollerwerbsbetrieben haben sich nur etwa 10 Prozent auf biologischen Anbau spezialisiert. Die Ökologische Landwirtschaft bleibt in einer Nische. Dabei hat sie mehr zu bieten als gesunde Lebensmittel: Sie erhält unsere Natur und läßt uns im Idealfall wissen, wo unsere Nahrung her kommt.

Dies ist beispielsweise beim Prinzip der Abokiste Hemhofen der Fall. Der Lieferservice hat ausschließlich Bioprodukte im Angebot. Viele werden sogar am Hof selbst produziert.

Die Solidarische Landwirtschaft geht noch einen Schritt weiter: Durch die Mitgliedschaft entsteht ein enges Verhältnis zwischen Landwirt und Verbraucher. Der kann sogar bestimmen, was auf dem Feld angebaut werden soll.

Im Münzinghof hat man sich schon lange der bio-dynamischen Landwirtschaft verschrieben. Ein wichtiger Bestandteil des landwirtschaftlichen Kreislaufs ist dort die natürliche und wesensgemäße Rinderhaltung.













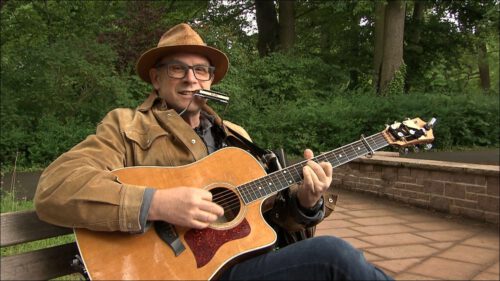



































Jüngste Kommentare